In
den Jahren 1938/39 erlebte Hombruch eine aktive Bautätigkeit,
welche zur Verbesserung des Wohnraumes führen sollte. Hombruch
war dabei nur ein Baustein in einem Plan, welcher zum Ziel hatte,
eine Süd-West-Siedlung innerhalb von Dortmund zu errichten.
Zwischen Hombruch und Renninghausen sollten alleine 4500 neue Wohnungen
entstehen.
Dieser von den
Nationalsozialisten ausgeführte Plan hatte eine reine politische
Zielsetzung: Jeder „Arbeiter“ sollte nahe seiner Arbeitsstätte
wohnen und leben, und das bei einem gehobenen Wohnungsstandard.
Aber es gab noch einen weiteren politischen Hintergrund. Mit diesen
Mustersiedlungen wollte man die Ballung von Arbeitern verhindern,
da diese nach Auffassung der Nationalsozialisten leicht vom Marxismus
beeinflusst werden konnten.
Also wurde diese Siedlung „für alle“ geöffnet.
Hier sollte der Beamte, der Kaufmann, der Handwerker, also alle
Schichten des Volkes wohnen in Wohnungen, die schöner und hygienischer
als die anderen Wohnungen in Hombruch waren.
Zu dieser Zeit hatte noch ein Großteil der Hombrucher Mietwohnungen
das „Plumps-Klosett“ im Hof.
Hier
sieht man die geplante Süd-West-Siedlung von Dorstfeld
bis Hörde.
Würden auf dieser Zeichnung die Industrieanlagen eingezeichnet
könnte man deutlich erkennen, dass der Weg zu diesen
Arbeitsstätten sehr kurz war. Allerdings wurde bei dieser
Planung nicht berücksichtigt, dass einige Industriebereiche
rückläufig waren und eine Blütezeit nur noch
durch den anstehenden Krieg hatten. |
Ein weiteres
Ergebnis dieser Süd-West-Ausrichtung war die Streichung der
Ausbaupläne im Dortmunder Norden, also eines gewachsenen Siedlungsraumes,
mit der Begründung, dass der Dortmunder Norden ein Bergschadengebiet
sei.
Dies mag zum Teil stimmen, aber die Situation war in dem Süd-West-Bereich
nicht besser.
Dem Proletariat gehörte der Norden, dem Besitzenden der Dortmunder
Süden.
Bedrängte Wohnverhältnisse sorgten für eine Abwanderung
und damit zu einer Verelendung des Dortmunder Nordens.
Dies kam den Machthaber gelegen, da die Ansammlung von Arbeitern
anfällig für die Lehren des Marxismus war.
Trotz aktiver Bautätigkeit in Dortmund fehlten 1939 über
20000 Wohnungen.[1]
Bau-
und Siedlungsbaupolitik im Nationalsozialismus
Der soziale Wohnungsbau
im III. Reich wurde vor allem unterschieden in „Volkswohnungen“
und „Kleinsiedlungen“ (auch Siedlungsstellen genannt).
Kleinsiedlungen wurden bis zum Kriegsbeginn aus politischen Gründen
bevorzugt, da die Kleinsiedlung dem Eigentümer die Möglichkeit
der Selbstversorgung durch einen kleinen Garten und eingeschränkte
Nutztierhaltung ermöglichte und dem gewünschten Familienzuwachs
keine Schranken setzte. Durch den Besitz eines eigenen Heimes sollte
sich der Arbeiter zudem mehr mit dem eigenen Boden verbunden fühlen
und band ihn so verstärkt an die deutsche Heimat (Blut-und-Boden-Ideologie).
Eine Kleinsiedlung oder
Siedlungsstelle wurde in der Benutzungsordnung geregelt. Es waren
meist Siedlungen, welche durch organisierte Gruppenselbsthilfe entstanden
sind; heute sind diese Siedlungen nicht mehr zeitgemäß,
da sie zu viel Land verbrauchen.
In Hombruch gibt es noch
eine Siedlung, welche diesen Charakter hat, an der Hohe Braukstraße.
Diese Siedlung wurde gebaut mit Hilfe und für die Vertriebenen.
Volkswohnung hingegen
war alles, was nicht einer Kleinsiedlung, sprich einer isolierten
Einheit der deutschen Familie, entsprach. Volkswohnungen waren billige
Mietwohnungen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, die bis zum
Kriegsausbruch weniger erwünscht waren, da sie vor allem das
nationalsozialistische Ideal der kinderreichen Familie nicht entsprachen.
Mit Beginn des Krieges
rückte aber die Sparsamkeit und Funktionalität des Wohnungsbaus
wieder vermehrt in den Vordergrund, welche typisierte und rational
ausgearbeitete Baupläne und Verfahren besser erfüllten
als der aufwändige Bau von Kleinsiedlungsstellen. Ziel der
nationalsozialistischen Siedlungsplanung war eine Durchmischung
von ein- und zweigeschossigen Kleinhäusern und Mehrfamilienhäusern
mit möglichst nicht höherer Geschosszahl, die einen harmonischen
Zusammenklang bilden sollten und sich in das Stadtbild einzupassen
hatten.
Neben diesen politischen
Bauvorgaben musste der Architekt sich auch nicht minder wichtigen
ästhetischen Regeln unterwerfen, die 1936 als „Baubedingungen
der Stadt Waren“ (an der Müritz) vom Stadtbaurat Pinnow
herausgegeben wurden. Diese ästhetischen Bauvorgaben hatten
den Schutz des Stadtbildes unter Verwendung regionaler Baustoffe
und -formen zum Ziel. Die Baubedingungen beinhalteten unter anderem
die Umsetzung der Bauten als Ziegelrohbau mit Verfugung mit weißem
Kalkmörtel, schiefergrau gedeckte Steildächer, die einen
Neigungswinkel nicht unter 45° aufweisen mussten und bündig
mit der Mauer einsetzten, und weiß gestrichene Fensterrahmen.
Diese Richtlinien greifen die traditionellen Bauformen des norddeutschen
Raumes auf und dienen der Harmonisierung von altem und neuem Stadtteil.
Die Siedlung
Unter dem nationalsozialistischen
Regime setzte sich immer mehr die Auffassung durch, sogenannte Volkswohnungen
(Kleinwohnungen nahe den Industriewerken) zu bauen. Renninghausen
erfüllte diese Anforderungen. Es gab um Hombruch herum mehrere
Zechenbetrieb, es gab in Barop das Walzwerk und in Hörde das
Stahlwerk Phönix.
Die Wohnungsbaupolitik
stand unter dem Vorgabe, Dortmund als Rüstungsstadt auszubauen.
Propagandistisch wurde die dazu gehörende geplante und durchgeführte
Bautätigkeit herausgestellt. Eine wirklich ausgefüllte
Baupolitik wurde erst nach den Schrecken der Bombardierungen zu
Friedenszeiten vorgenommen.
Es gab bei den Planern
aber einen Widerspruch zwischen angekündigter Bautätigkeit
und deren Realisierung. Diesen Widerspruch gab es in vielen Bereichen
nationalsozialistischer Ankündigung bzw. Plänen. Besonders
groß war diese Diskrepanz im Baubereich. Jede Bautätigkeit
wurde deshalb mit riesigem „Tamtam“ durchgeführt,
und sei sie noch so unbedeutend.

Rudolf
Hess, Gauleiter Josef Wagner und Kreisleiter
Friedrich Hesseldieck bei der Besichtigung eines
Modells im Alten Rathaus |
| |
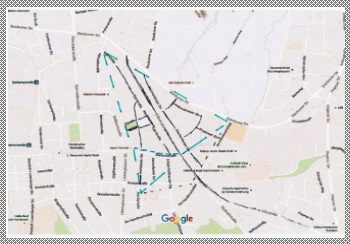
Die blaue
Linie umschließt das Land der St.-Clemens
Gemeinde und der schwarze Teil das gepachtete Land |
| |
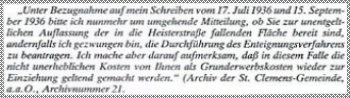 |
| |
Anfang 1938 konnte der
Betriebsführer der Hörder Hüttenwerke eine Siedlung
von 20 Häusern einweihen.
Mit großem Presseaufwand wurde
dies als riesige Leistung heraus gestellt und als Teil der kommenden
Großsiedlung Dortmund Süd gefeiert. Gleichzeitig wurde
der Dortmunder Bevölkerung zu Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk
versprochen, wie man es sich nicht besser vorstellen
konnte: Eine
neue „Stadt“, die Rudolf Hess Stadt.
Der Stadtentwurf von
dem Dortmunder Architekten Joseph Wentzler in Verbindung mit dem
Oberbürgermeister Willi Banike wurde als „Stadt des deutschen
Sozialismus“ bezeichnet. Für Dortmund war der Bau dieser
Siedlung
eine Ehre.
Vorbereitung
der Bauphasen
Unter diesen Voraussetzungen
führten diese
Verhandlungen zu der Planung des ersten
Bauabschnittes.
I. Bauabschnitt: der
Raum südlich und nördlich der Zillestraße, welche
in Sudeten-Damm umbenannt wurde.
Die Straßen sollten als symbolischen
Akt und zum
Gedenken an das:Münchner Abkommen den Namen sudetendeutscher
Städte tragen: Marienbader, Eger-,
Karlsbader, Reichenberger,
Aussig-, Tetschener,
Troppauer, Leitmeritz- und Trautenauer Straße.
II. Bauabschnitt: Erweiterung
der Siedlung bis hinter
Barop entlang der Stockumer Straße.
Hier sollte aber die
gewachsene Struktur der Ortschaften Barop und Eichlinghofen erhalten
bleiben und die neuen Siedlungen
um die bestehenden Häuser herum geführt werden. Die Stockumer
Straße
sollte aber eine wichtige Verkehrsader bleiben.
III. Bauabschnitt: Erweiterung
entlang der Stockumer Straße bis hinter Eichlinghofen
IV. Bauabschnitt: von
Eichlinghofen bis Ortsbeginn Dorstfeld
V. Bauabschnitt: bis
Ortsbeginn Hörde entlang der Zillestraße
VI. Bauabschnitt: von
Renninghausen über die heutige Bolmke bis Stadion Rote Erde
und Volksbad; beide Sportstätten sollten in dieser Süd-West-Stadt
aufgehen
Die einzelnen Bauabschnitte
sollten 1945 abgeschlossen sein. Es kam nur zum teilweisen Bau des
I. Abschnitts, da der beginnende Krieg weitere Ausführungen
nicht zuließ.
Ausführung
der Häuser

Nur
wenige Häuser wichen von der Norm ab, wenn in dem
Haus z.B. ein Geschäft untergebracht war. Das Wandbild
ist heute noch vorhanden. (Foto: H. Tibbe) |
| |

Diese Erker
mit den Ornamenten verschwinden immer mehr
aus Kostengründen, da das Holz in kürzeren Zeiträumen
gestrichen werden muss. Auch energetische Maßnahmen
lassen diese Erker verschwinden. (Foto :H. Tibbe) |
Die Häuser waren
in ihrer Ausführung absolut identisch. Aufgrund der Zweckmäßigkeit
wurde kaum Eisen und Stahl verbaut, da man diese Materialien, diese
Industriegüter, für die Rüstung benötigte. Es
wurde eine einfache Holzbauweise bevorzugt.
Die Wohnungen waren in
ihrer Aufteilung, in ihrem Schnitt absolut identisch. Ein Umzug
aus der Egerstraße in die Trautenauer Straße konnte
ohne „Ausmessen“ vorgenommen werden da alle Wohnungsarten
(2- oder 3-Zimmer-Wohnungen) die gleichen Maße hatten. Weiterhin
gehörte zu jeder Wohnung ein kleiner Garten, damit der Arbeiter
durch selbst angebautes Gemüse seine Ernährung verbessern
konnte. Die geplanten „Stallungen“ (Platz für höchstens
ein Schwein) wurde schon nicht mehr angefangen, da die kriegsbedingten
Sparmaßnahmen griffen.
Auch sonst zeigte der
beginnende Krieg seine Auswirkungen. In jedem Haus wurde die Waschküche
als Luftschutzkeller erbaut. Noch heute sind trotz gründlicher
Renovierung in vielen Häusern in den Waschküchen die Eingangstüren
als Luftschutztüren aus Stahl vorhanden. Auch konnte man von
einem Haus zum anderen durch kleine Türen gehen, um im Falle
einer Zerstörung des Hauses den „Luftschutzraum“
verlassen zu können.
Weiterhin sollten Erker
und Wandbilder den Mustercharakter der Siedlung unterstreichen.
 |
Detail der Brüstung
(Foto; H.Tibbe) |
|